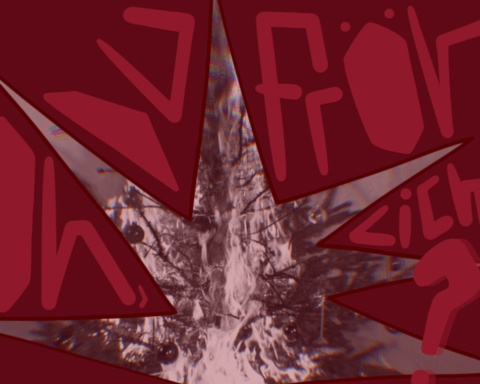Manche Abende im Spätsommer, wenn die spektakuläre Umtriebigkeit der Sommermonate und die Unbeschwertheit, die damit einherging, nachlässt, man wieder mehr Zeit Zuhause verbringt, der Ernst des Lebens einen wieder einholt und melancholische Herbstgefühle sich breiter und breiter machen, mache ich mich auf den Weg zu „meinem Platz“: eine Straßenbrücke aus den Gründerjahren, benannt nach Reichskanzler Otto von Bismarck, die über die Eisenbahnschienen, die meine Heimatstadt durchschneiden, führt. Ich bin nicht der Einzige, der diesen Ort „seinen Platz“ nennt, aber das ist mir und den anderen Leuten, die hier sind, relativ egal. Entweder weil sie mit ihrer neuen Flamme, die sie beim Nacktyoga kennengelernt haben, hier sind, oder weil sie so Menschen sind wie ich. Menschen, die gerne Arbeiten, gerne Diskutieren, gerne Zeitung lesen und an guten Tagen sogar gerne Hausaufgaben machen. Die sich aber auch Zeit nehmen für sich, für Muße. Menschen wie ich werden von manch Anderen gerne belächelt.
Ich sitze meistens alleine auf einem 1,80m mal 1,80m großen Steinklotz, der inmitten des Brückengeländers steht und von dem aus sich eine Laterne mit vier warmweiß leuchtenden Kugeln in Richtung Himmel reckt. Und so sitze ich da, am Laternenpfahl lehnend, meistens für nicht mehr als eine halbe Stunde, trinke ein alkoholfreies Radler und schaue der Sonne beim Unter-, und den Menschen beim Vorbeigehen zu. Ich befinde mich in einem Stadium des aktiven Nichtstuns. Das finden einige augenscheinlich komisch. Mitunter werfen mir vorbeifahrende Autofahrer verständnislose Blicke aus ihrem übergroßen BMW entgegen, als wollten sie mir sagen ich solle mal von da runterkommen und den Müll rausbringen.
Mich aber stört das nicht im Geringsten. Tief in Gedanken, manchmal, aber nicht immer, auch in meditativer Musik versunken, fröhne ich dem Nichtstun. Es gibt mir Kraft, es läutert mich, es lässt mir Zeit zum Nachdenken. Und, ganz nebenbei, ist es einfach schön. Das ist es wohl was Oscar Wilde meinte, als er die Muße als Verteidigung der Vollkommenheit bezeichnete. Denn, während gestresste Autofahrer auf dem Weg von der Anwaltskanzlei zum After-Work-Clubbing in meinem Verhalten keinen Mehrwert finden können, und ein wenig aus ihrem getönten Fenster auf mich herabsehen, erwische ich mich manches Mal dabei wie auch ich (nicht nur buchstäblich) auf sie herabsehe. Sie, die jeder Minute ihres Lebens einen produktiven Mehrwert abgewinnen wollen. Sie die finden, der Sinn des Lebens sei es, gutes Geld zu verdienen, ein Haus zu kaufen und schöne Kinder mit einer schönen Frau zu zeugen, nur um selbige dann mit Namen wie Jérome-Felix oder Katharina-Amalia zu strafen. Mir scheint es immer als würden diese Menschen ihr Leben der Prämisse unterstellen, dass ein erfülltes Leben vor Allem auf wirtschaftlichem Erfolg und spektakulären Erfahrungen, einer super ausgewogenen Work-Life-Balance also, fußt. Es tut mir leid das so zu sagen, aber das ist für mich kein erfülltes, kein vollkommenes Leben.
Man möge mir nun entgegnen, dass diese Menschen Muße eben im erfrischenden After-Work-Clubbing oder beim total entkrampfenden Nacktyoga fänden, und nicht beim plumpen Herumlungern auf einer Brücke, deren Bau mit französischen Reparationszahlungen nach dem Krieg von 1870/71 finanziert wurde. In Ordnung, das mag wohl für Einige so sein. Doch unter echter Muße verstehe ich etwas anderes. Um es mit dem Journalist und Autor Ulrich Schnabel zu sagen: “Wer Muße nur als Zeit der Fitness und der Wellness versteht, unterwirft sie prompt wieder dem Nützlichkeitsdenken, das schon unsere Arbeit regiert.”
Somit ist also After-Work-Clubbing zur Erfrischung keine Muße, sondern ein Mittel der Produktivitätssteigerung, da der Ausgleich, den es zum Arbeitsalltag bietet, vor Allem dem Zweck dient, am nächsten Tag noch entspannter und motivierter für Klientinnen und Klienten Unterlassungsklagen gegen irgendwelche Kinder, die am Straßenrand Saftschorle verkaufen, zu verfassen, da diese die Existenz des eigenen Spirituosengeschäftes mit Mitteln des unlauteren Wettbewerbs und ohne Gewerbeschein in ernsthafte Gefahr bringen.
Schon Friedrich Nietzsche sprach seinerzeit von einer „Plumpen Deutlichkeit“, die die Gesellschaft ob der Vorherrschaft des ökonomischen Imperativs durchdringe. Er beklagte, der Mensch würde sich nicht mehr für den Esprit der Unterhaltung interessieren und keine Kraft mehr für Zeremonien, die Bestandteil eines lebendigen Miteinanders sind, aufbringen, weil sie keinen wirtschaftlichen Vorteil versprechen. Sicher, Nietzsche war, auch für damalige Verhältnisse, ein Querdenker. Doch sind seine Überlegungen für uns heute alles andere als bedeutungslos. Die Angst, irgendetwas versäumen zu können, die er bereits im 19. Jahrhundert beschrieb, ist für die Generation U30 heute bitterer Alltag, die unser Verhalten und unser Denken maßgeblich steuert. Die Bereitschaft, für die Jagd nach Gewinn fortwährend „seinen Geist bis zur Erschöpfung auszugeben“, wie er es damals beschrieb, äußert sich heute auf tragische Weise in Krankheiten wie Burn-Out oder chronischer Depression. Und das Verständnis von der Arbeit alleine als tugendhafte Betätigung diktiert unsere Einstellung zum Leben im Ganzen und zu dem, was uns in ihm wichtig ist.
So werden wir – Ihr, ich, der BMW-Fahrer und alle Anderen auch in der heutigen Zeit, in der der Zwang, ewiges Wachstum und unbegrenzte Produktivitätssteigerung zu erreichen die Leitplanken allen Tuns darstellt, unserer Fähigkeit zum Nichtstun beraubt. Längst hat sich ein Stigma gelegt auf das bewusste Nichtstun, manch einer schämt sich gar dafür, sich erholen zu wollen. Dabei ist es genau dieses bewusste Nichtstun, das das Leben so richtig lebenswert macht. Wenn man es sich erlaubt, mit seinen Gedanken alleine zu sein und ganz bewusst gar nichts zu tun, richtet sich die Aufmerksamkeit des Gehirns nach innen, so beschreibt es der Neurophilosoph Evan Thompson. Professor Hartmut Rosa, renommierter Soziologe und ausgewiesener Spezialist für Entschleunigungstheorie, rät uns, der Muße mehr Zeit einzuräumen und uns nicht aus Furcht vor den eigenen Gedanken in die Dauerstimulation zu flüchten. Denn die Wendung des Geistes nach innen, die der wahren Muße inhärent ist, ist mit das wertvollste, was wir haben. Sie befähigt uns, in Kontakt mit uns selbst zu treten, zu erfahren was uns Freude macht, was wir wirklich wollen und wovor wir Angst haben. Solange wir uns nicht dieser Möglichkeit bedienen, mit uns selbst ins Reine zu treten, werden wir weiter laufend unseren Wohnort, unsere Partner, unsere Jobs und unsere Freunde wechseln, zwei Drittel der Deutschen werden sich weiter zumindest gelegentlich gestresst fühlen und ich werde beim Ausspannen auf meiner Brücke wahrscheinlich noch häufiger verständnislosen Blicken ausgesetzt sein.