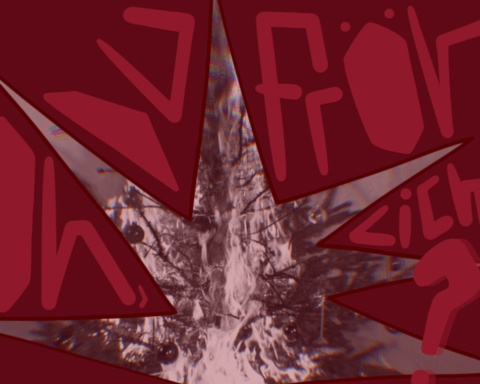Wir alle kennen und tragen sie selbst: die subjektive Brille. Wir laufen mit ihr durch die Welt, blicken durch sie auf alles, was um uns passiert und beziehen sie ganz automatisch in alle Bewertungen, Meinungen und Entscheidungen mit ein. Das ist menschlich und natürlich. Keiner kann sich frei machen von individuellen Erfahrungen, Einstellungen und Werten. Auch nicht Menschen, die journalistisch arbeiten.
Mich selbst beschäftigt die Frage nach der richtigen Dosis von subjektiven Einflüssen in journalistisches Arbeiten tagtäglich. Nebenbei arbeite ich fürs Bonner Uniradio und bin dort zurzeit für alle Nachrichten verantwortlich, die in den täglichen Radiosendungen gesprochen werden. Hier bin ich oft selbst der Filter und muss entscheiden, über welches Ereignis oder Thema berichtet wird und worüber nicht. Aber darf und sollte ich überhaupt entscheiden, welche Nachrichten andere erreichen und welche nicht? Und woran mache ich fest, welche Meldungen relevant genug sind, damit sie gesendet werden?
Meist ist es bei mir persönlich eine klare Abwägung: im Uniradio sind Berichte über die Unibibliothek wichtiger als über Kindergärten, und der Ausbau von Radwegen oder einer neuen 30er-Zone relevanter als etwa der Bau neuer Einfamilienhäuser. Klingt für mich logisch und schlüssig. Und es ist ja auch meine Aufgabe zu filtern, Nachrichten aufzubereiten und überhaupt erst mitzubekommen. Ansonsten bräuchte es das journalistische Medium gar nicht. Außerdem erwartet meine Zielgruppe, Bonner Studierende, in gewisser Weise genau das: nämlich, dass sie bei uns alle Infos rund um die Uni, den Campus und Bonn bekommen, die sie in anderen Medien nicht erhalten. Und da ich selbst Teil meiner Zielgruppe bin, muss ich mich theoretisch nur fragen, was meine eigenen Ansprüche an die Thematisierung von Inhalten ist.
Die eigene Wahrnehmung ist immer Teil der Berichterstattung
Dabei ist genau das ein entscheidender Punkt: in die Auswahl der einzelnen Inhalte fließen nämlich auch meine eigene Wahrnehmung der Wirklichkeit und die Erwartungen an meine journalistische Arbeit mit ein. Meine Vorstellung und auch Überzeugung von Inhalten, die Bonner Studierende interessieren und die sie wissen sollten, leiten mich bei der Auswahl der Themen. Rein objektiv ist meine Arbeit also nicht.
Und wie siehts abseits des zielgruppenorientierten Journalismus aus?
Blicken wir darüber hinaus, zeichnen sich allerdings ähnliche Muster ab. Bevor uns die tagtäglichen Weltnachrichten erreichen, durchlaufen sie auch bei allen großen Medienhäusern viele Selektionsprozesse. Sie werden unter Aspekten der Relevanz, der Außergewöhnlichkeit oder auch der Bedeutsamkeit gefiltert. Auch hier entscheiden Journalist:innen anhand ihrer individuellen Wahrnehmung, welche Inhalte berichtenswert sind.
Die Entscheidung, über welche Inhalte berichtet wird, ist also nie objektiv und kann sie auch gar nicht sein. Jede Form journalistischer Arbeit entsteht aus einer subjektiven Perspektive. Auch dieser Text ist nicht objektiv. Er beinhaltet meine eigene Wahrnehmung von den Problemen der Subjektivität innerhalb der Berichterstattung. Die Aufgabe von berichterstattenden Personen kann also gar nicht sein, “die eine Wirklichkeit” aufzuzeigen. Vielmehr haben sie die Aufgabe, zwischen Geschehnissen und der großen Öffentlichkeit zu vermitteln.
Und was ist die Lösung?
Eine einfache Lösung gibt es hier, wie eigentlich überall, nicht. Journalistisch zu arbeiten und für andere der Filter zu sein, bedeutet immer abzuwägen, zu hinterfragen und zu überlegen, was der Wirklichkeit am nächsten kommt. Dabei sollte die Darstellung der Wirklichkeit stets für Rezipient:innen verständlich und nachvollziehbar sein. Wenn also Objektivität nicht der Maßstab sein kann, kann Transparenz der Weg sein, um Berichterstattung zu ermöglichen, die nicht lediglich subjektive Perspektiven aufzeichnet. Vielleicht ist es also an der Zeit, Objektivität nicht weiter als oberstes Ziel journalistischer Arbeit zu verstehen, sondern anzuerkennen, dass Transparenz im Journalismus uns viel mehr gibt, was wir brauchen: nämlich Medien, die uns, wie es Spiegel-Gründer Rudolf Augstein sagt, “sagen, was ist.”