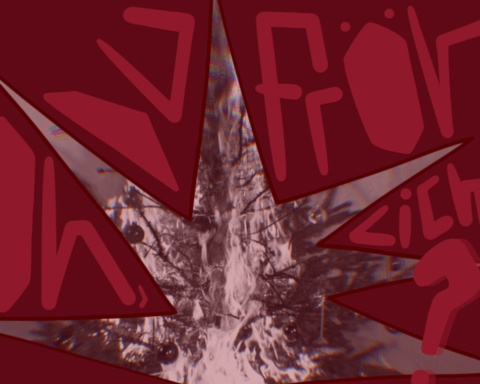Wenn Leute mich fragen, ob ich eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch bin, finde ich das vor allem nervig und sinnlos. Ich hab dann immer gesagt ich bin ein Katzenmensch, weil ich eine Katze habe, und um diese Frage möglichst schnell vom Tisch zu haben. Aber auch wenn unsere Katze toll ist, wollte ich schon seitdem ich denken kann einen Hund. Meine Eltern standen dem Hundebesitz immer eher skeptisch gegenüber – sie wollten zwar, aber wollten es gleichzeitig nicht genug, als dass sie bereit gewesen wären, Zeit und Energie in ein weiteres Lebewesen zu stecken, das nicht ich oder mein Bruder war.
Ich habe 20 Jahre meines Lebens recht viel Energie da reingesteckt, einen Hund zu bekommen. Drei Tage nach meinem 21. Geburtstag und anderthalb Jahre, nachdem ich ausgezogen war, habe ich dann unseren Hund im Arm gehalten. Wie ich das geschafft habe? Ich war um ein Vielfaches nerviger, als die Leute, die einen fragen, ob man eher Hunde- oder Katzenmensch sei. (Der Fakt, dass sie eigentlich immer einen Hund haben wollten, ich ausgezogen bin und mein Bruder alt genug war, um nicht mehr 24/7 beaufsichtigt zu werden und meine Eltern de facto für kein Lebewesen mehr allzu viel Verantwortung tragen mussten als sie selbst, hat bestimmt auch dazu beigetragen.)
Ich hatte mir in der Zeit, in der ich überreden, betteln, überzeugen und manipulieren musste, ständig ausgemalt wie es wäre, einen Hund zu haben. Und es ist tatsächlich so schön, wie es sich Leute vorstellen, die sich einen Hund wünschen. Dass Hunde einen positiven Effekt auf unsere physische und psychische Gesundheit haben, ist keine neue Erkenntnis. Und das hat viele Gründe: Man muss mit dem Hund Routinen entwickeln, die unseren Tagesablauf strukturieren und uns zu mehr Bewegung zwingen, sie sind soziale Katalysatoren, denn es gibt kaum einen Spaziergang, bei dem man nicht mit anderen Hundebesitzer:innen ins Gespräch kommt und wenn wir Tiere streicheln, dann wird Oxytocin, ein Bindungs- und Wohlfühlhormon ausgeschüttet. Laut der Harvard Medical School machen uns Hunde dadurch stressresistenter und entspannter. Außerdem fühlen wir uns mit ihnen geborgener, denn man erfährt eine bedingungslose Liebe, die nicht an klassische Attribute, wie zum Beispiel Aussehen oder sozialer Status gebunden ist. Es ist ihnen egal, wie scheiße man sich hin und wieder verhält, wie man aussieht, wie man riecht oder welche komischen Angewohnheiten man hat. Andersherum muss ich aber zugeben, dass es mir absolut nicht egal ist, wie scheiße er sich hin und wieder verhält, wie er aussieht, vor allem wie er riecht und welche komischen Angewohnheiten er hat. Manchmal ist er richtig eklig. Und nervig. Um ein vielfaches nerviger, als die Leute, die einen danach fragen, ob man eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch ist.
So gut sie uns tun, so süß sie sind und so sehr sie uns zum Lachen bringen, glaube ich, dass viele, die keinen Hund haben aber gerne einen hätten, eine sehr verklärte Sicht darauf haben, wie es tatsächlich ist einen Hund zu haben. Ich glaube, den meisten von uns ist bewusst, dass sie viel Arbeit mit sich bringen. Dass es so viel mehr ist, hätte ich allerdings am Anfang auch nicht gedacht. Einen Hund zu haben ist zwar unfassbar schön, jedoch sollten wir endlich von dem romantisierten Bild dessen wegkommen. Sie zu verstehen ist schwer, und ihre Sprache zu lernen und herauszufinden, wie man sie richtig erzieht, ist noch schwerer. Ich hatte Spaziergänge, bei denen ich so wütend auf ihn war, und welche, nach denen ich zum einen vor Frust und gleichzeitig weil er mir deswegen leid tat, geweint habe. Ganz zu Anfang, als er noch ein Welpe war, kamen mir in schwierigeren Momenten manchmal sogar ganz kurze, aber ernsthafte Gedanken, wie: Sollten wir ihn zurückgeben? Können wir ihn überhaupt noch zurückgeben? Was sollen wir dem Pärchen, das ihn uns verkauft hat, bloß sagen, wenn wir vor ihrer Tür stehen? Und das, obwohl ich diejenige war, die ihn am meisten wollte.
Und deshalb sollte man wirklich, wirklich ganz angestrengt darüber nachdenken, ob man auch wirklich bereit ist die negativen Aspekte, die bei der Hundeanschaffung auf einen selbst zukommen, in Kauf zu nehmen, bevor man sich dazu entscheidet, einen Hund ins Haus oder in die Wohnung zu holen. Denn ich habe das Gefühl, viele Menschen nehmen sich zum Denken nicht genug Zeit. Damals, als die Corona-Lage noch so ernst war, dass wir in multiplen Lockdowns steckten und viele Menschen einsam waren erst recht nicht. Letztes Jahr wurden laut dem Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) im Vergleich zu den Vorjahren 20 Prozent mehr Hunde angeschafft. Als es dann durch die Eindämmung des Virus wieder möglich war, zurück ins Büro zu gehen, sich mit Freund:innen zu treffen oder in den Urlaub zu fahren, passte der Hund auf einmal doch nicht mehr in den Alltag. Rund jeder vierte Hund, der aktuell ins Tierheim gebracht wird, sei ein Corona-Hund, sagt Kristina Brechthold vom Tierheim München in einem SPIEGEL-Interview. Es überrascht mich nicht, jedoch erschreckt es mich gleichzeitig, wie wenig es mich schockiert.
Kleiner Spoiler: Wir haben unseren Hund nicht zurückgegeben. Und das ist gut so. Er tut uns allen unfassbar gut. Er passt zu mir und zu meiner Familie und ich liebe ihn mehr, als die meisten Menschen, die ich kenne. Und trotzdem war es so, dass ich ein – wenn nicht sogar zwei – Monate gebraucht habe, um ihn wirklich lieben zu lernen. Die Leute, die einen danach fragen, ob man eher Hunde- oder Katzenmensch ist, werde ich jedoch vermutlich nie lieben lernen.