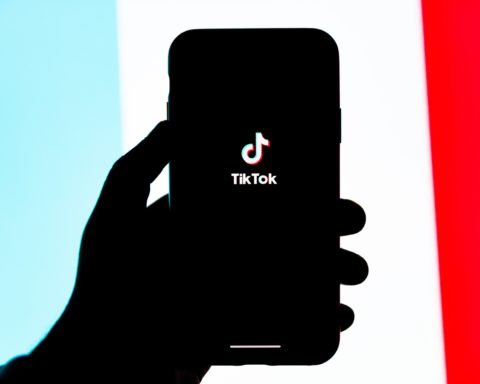In den vielen Diskussionen, in die man als politisch interessierter Mensch immer wieder hineingerät, gibt es ein Thema, bei dem jedes Mal die Fetzen fliegen. Eine Debatte, bei der auf allen Ebenen der möglichen Positionen, wahnsinnig emotionalisiert und moralisiert wird.
Über keine andere Frage habe ich mich je so leidenschaftlich gestritten, wie über das Thema der Steuergerechtigkeit. Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand jemals einen Konsens in dieser Frage gefunden hat. Wenn es gut läuft, geht man mit dem Satz “Let’s agree to disagree” aus diesen hitzigen Gesprächen heraus. In der Debatte um Steuergerechtigkeit wird mit allen Mitteln gekämpft; als Verfechter dieses Ideals wird man in besagten Auseinandersetzungen allzu häufig in einer Reihe mit Mao Zedong, Josef Stalin und Erich Honecker gestellt oder als Enteignungsfetischist bezeichnet. Manchmal verkörpert man in den Augen der Gegenposition all das auf einmal.
Dabei bin ich selbst einige weltanschauliche Lichtjahre von oben genannten Persönlichkeiten entfernt. Ich bin froh über die Privilegien, die die Marktwirtschaft mir, meiner Familie und vielen anderen Menschen in meinem Land beschert. In unserem Wohlstand, genauso wie im weiteren Sinne auch im Frieden und den Freiheiten, die wir alle, mehr oder weniger gleichermaßen, im geeinten Europa genießen dürfen, lässt es sich gut suhlen. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, wie ungerecht dieses System allzu häufig ist, wie viele Menschen in miserablen Verhältnissen leben und arbeiten müssen, damit ich mir meinen privilegierten Lebensstil erlauben kann. Die Annahme, ich sei ein waschechter Kommunist, wie es mir einige Menschen, mit denen ich die Debatte um Steuergerechtigkeit geführt habe, gesagt haben, scheint angesichts dessen doch etwas weit hergeholt.
Nichtsdestotrotz, bin ich für eine stärkere Besteuerung von großen Einkommen, besonders aus Kapitalerträgen. Nicht, weil ich neidisch auf Wohlhabende bin. Auch nicht, weil ich ihnen ihren Erfolg nicht gönne, sondern weil ich finde, dass einigermaßen angeglichene Lebensverhältnisse notwendig sind für ein Gemeinwohl. Außerdem sehe ich es als Verantwortung des Staates an, durch Steuerpolitik dafür zu sorgen, dass der Reichtum, den der Kapitalismus hierzulande produziert, auch allen im Land und darüber hinaus in irgendeiner Weise zugute kommt. Ich glaube wir sind uns alle einig, dass es einfach nicht gerecht ist, wenn Menschen im reichen Deutschland unter einer Brücke schlafen müssen, während andere Millionen verdienen und sich diese Brücken kaufen könnten, wenn sie wollten.
Mir wird an dieser Stelle in eingangs erwähnten hitzigen Diskussionen häufig erwidert, es wäre ungerecht, Vermögen über Steuern gerechter zu verteilen. Das sei die Aufgabe des freien Marktes. Alles andere widerspräche dem Leistungsprinzip. Aber ist es nicht ganz schön gewagt, Pflegekräfte in 14-Stunden-Schichten oder übermüdeten LKW-Fahrer:innen implizit vorzuwerfen, sie würden einfach nicht hart genug arbeiten, um in dieser Gesellschaft besser gestellt zu sein? Immerhin heißt es wer hart genug arbeitet, schafft es auch (finanziell) erfolgreich zu sein. Und wenn wir mal bei dieser Argumentation bleiben, ist es nicht absurd zu behaupten, ein Immobilienerbe rechtfertige den hohen Lebensstandard? Wirklich hart wurde da von den Erbenden ja nicht gearbeitet. Den Begriff Leistung in einen linearen Zusammenhang mit Einkommen oder Vermögen zu stellen, ist meines Erachtens grober Unsinn. Es ist vielmehr ein vorgeschobenes Argument, um der wachsenden sozialen Ungleichheit in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt, nichts entgegnen zu müssen.
Was mich an der Aussage man solle hart genug arbeiten, denn dann könne es jeder schaffen, besonders stört ist, dass dabei so getan wird, als könnte man Berufe und was man in diesen leistet, überhaupt gegeneinander aufwiegen: Altenpfleger:innen leisten wenig, deswegen haben sie wenig Geld, Germanistikprofessor:innen leisten viel, also verdienen sie mehr Geld. Aber wer definiert denn hier Leistung? Und was ist mit unbezahlter Care-Arbeit oder ehrenamtlichen Engagement? Es handelt sich um eine meiner Meinung nach vollkommen willkürliche Kategorisierung, wenn man Arbeit an ihrer Rentabilität zu messen versucht.
Der Diskurs um Leistungsgerechtigkeit widerspricht einem eigentlich schon lange erzielten, gesellschaftlichen Konsens, dass der Wert von Menschen und ihrer Arbeit nicht vom Inhalt ihres Geldbeutels abhängt. Dieser Konsens wurde über Jahrhunderte der Aufklärung und des Arbeitskampfes mühsam erstritten. Er ist essentiell für das moderne, egalitäre Menschenverständnis, das viele zu haben glauben. Und doch sträuben sich diese Menschen allzu oft dagegen, Leistung unabhängig von Gehalt zu betrachten und Biographien nicht mehr anhand des willkürlichen Maßstabs des damit verdienten Geldes zu bewerten – auch wenn das häufig lediglich im Unterbewusstsein dieser Leute passiert.
Steuergerechtigkeit ist genau so eine moralische Frage, wie die Frage des gesellschaftlichen Zusammenlebens und sollte deshalb nicht mehr nur als eine volkswirtschaftliche Erwägung Platz im öffentlichen Diskurs finden, sondern als die für das Gemeinwesen zentrale Frage in Betracht gezogen werden, die sie ist. Denn eigentlich sind wir, ganzheitlich gesehen, als Land doch erfolgreicher, wenn wir uns nicht nur an abstrakten Wachstumszahlen und Gewinnmaximierung, sondern auch daran, niemanden im Elend versumpfen zu lassen, orientieren.